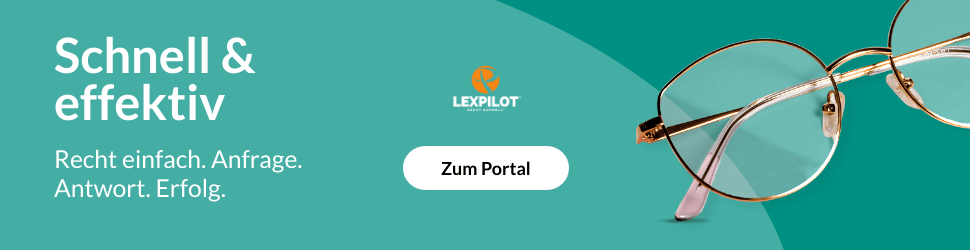Darum geht’s in diesem Artikel – Was erwartet dich?
Stell dir vor, du wohnst seit Jahren in deiner Mietwohnung, dein Leben spielt sich genau dort ab – und plötzlich flattert die Kündigung ins Haus: „Wegen Eigenbedarf.“
Für viele Mieter ist das ein echter Schock. Man fühlt sich machtlos, überrumpelt, vielleicht sogar ungerecht behandelt. Denn häufig steht hinter der Kündigung nicht ein nachvollziehbarer persönlicher Bedarf, sondern das Ziel, die Miete zu erhöhen oder unliebsame Mieter loszuwerden.
Was viele nicht wissen: Nicht jede Eigenbedarfskündigung ist wirksam. Der Vermieter muss sehr genau darlegen, warum er – oder ein Familienmitglied – die Wohnung gerade jetzt und genau in dieser Form benötigt. Zudem gibt es zahlreiche Ausnahmen, Schutzmechanismen und rechtliche Instrumente, mit denen du dich wehren kannst.
In diesem Artikel erfährst du, was eine wirksame Eigenbedarfskündigung ausmacht, wie du deine Rechte wahrnehmen kannst und welche konkreten Schritte du unternehmen solltest, wenn du betroffen bist. Klar, verständlich, juristisch fundiert – damit du dich nicht einschüchtern lässt.
Was bedeutet „Eigenbedarf“ überhaupt?
Grundlage im Mietrecht
Eigenbedarf liegt dann vor, wenn der Vermieter die Wohnung für sich selbst, für nahe Familienangehörige oder Mitglieder seines Haushalts benötigt. Dazu zählen z. B. Kinder, Eltern, Geschwister oder Ehepartner, teilweise auch Schwiegereltern oder enge Lebensgefährten.
Der Eigenbedarf muss konkret, nachvollziehbar und ernsthaft sein. Es reicht nicht, pauschal zu sagen: „Mein Sohn braucht die Wohnung.“ Der Vermieter muss darlegen, warum genau diese Wohnung gebraucht wird, ab wann und in welchem Lebenszusammenhang.
Typische Probleme
Viele Kündigungen scheitern daran, dass die Begründung zu vage oder unplausibel ist. Auch formale Fehler oder ein unzulässiger Kündigungszeitpunkt können die Wirksamkeit infrage stellen. Wichtig: Als Mieter solltest du die Kündigung nicht einfach hinnehmen, sondern immer prüfen lassen.
Was du jetzt konkret tun solltest
1. Kündigung sorgfältig prüfen (lassen)
Zunächst solltest du kontrollieren, ob die Kündigung schriftlich erfolgte und eine detaillierte Begründung enthält. Allgemeine Aussagen ohne konkrete Angaben zur Person und zum Einzugswunsch genügen nicht. Auch Datum, Absender und Fristen müssen stimmen.
2. Widerspruch bei Härtefällen einlegen
Wenn dir der Verlust der Wohnung aus gesundheitlichen, sozialen oder familiären Gründen nicht zuzumuten ist, kannst du nach § 574 BGB Widerspruch einlegen. Die Frist: spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Auszugstermin.
Typische Härtefälle: Alter, Krankheit, Schwangerschaft, schulpflichtige Kinder, psychische Belastung oder Aussichtslosigkeit bei der Wohnungssuche.
3. Beweise sammeln
Wenn du einen Widerspruch einlegen willst, brauchst du Belege: ärztliche Atteste, Schulnachweise, Einkommensnachweise, Dokumentation der Wohnungssuche. Je besser du deinen Härtefall belegst, desto größer deine Chancen.
4. Das Gespräch suchen – aber nicht unter Druck setzen lassen
Manchmal lässt sich mit dem Vermieter ein Kompromiss finden – z. B. längere Auszugsfrist, Umzugshilfe, Abstandszahlung. Wichtig: Lass dich nicht zu vorschnellen Unterschriften drängen und unterschreibe niemals einen Aufhebungsvertrag ohne rechtliche Beratung.
Tipps der Redaktion
Viele Eigenbedarfskündigungen sind nicht wirksam – oder zumindest angreifbar. Nutze deine rechtlichen Möglichkeiten, bevor du aufgibst.
✅ Lass die Kündigung auf Form und Inhalt prüfen
✅ Widerspruch bei Härtefall mit Frist und Belegen einreichen
✅ Dokumentiere Wohnungssuche und Gesundheitszustand
✅ Verhandle nicht unvorbereitet – nutze anwaltliche Hilfe
✅ Rechtschutzversicherung oder Mieterbund kontaktieren
Hilfe findest du auch jederzeit auf unserer Hauptseite.
Eine kurze rechtliche Einschätzung durch die Expertenbrille
„Eine Eigenbedarfskündigung ist kein Freifahrtschein für Vermieter. Sie unterliegt strengen gesetzlichen Voraussetzungen – und genau das unterschätzen viele. Immer wieder erleben wir in der Praxis Fälle, in denen die Kündigung entweder formal fehlerhaft, sachlich ungenügend oder schlicht vorgeschoben ist. Als Mieter hast du starke Abwehrrechte, insbesondere wenn du dich in einer persönlichen oder gesundheitlichen Ausnahmesituation befindest. Entscheidend ist, dass du die Fristen kennst, deinen Widerspruch gut begründest und professionell dokumentierst. Mit der richtigen Strategie lässt sich in vielen Fällen der Auszug verhindern oder zumindest hinauszögern – oft verbunden mit finanziellen Zugeständnissen durch den Vermieter.“
Björn Kasper, Rechtsanwalt

FAQ – Die 7 wichtigsten Fragen zum Thema
Was ist eine Eigenbedarfskündigung und wann ist sie erlaubt?
Eine Eigenbedarfskündigung erlaubt dem Vermieter, das Mietverhältnis zu beenden, wenn er die Wohnung selbst oder für enge Angehörige benötigt. Sie ist nur zulässig, wenn der Bedarf ernsthaft besteht, plausibel begründet ist und die gesetzlichen Kündigungsfristen eingehalten werden. Es muss ein nachvollziehbarer Lebensplan zugrunde liegen, keine spekulative Absicht.
Welche Formvorgaben gelten für eine Eigenbedarfskündigung?
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und eine konkrete, nachvollziehbare Begründung enthalten. Der Vermieter muss angeben, wer die Wohnung nutzen soll und aus welchem Grund. Fehlt diese Begründung oder ist sie zu allgemein, ist die Kündigung unwirksam. Eine E-Mail oder mündliche Ankündigung reicht keinesfalls.
Was gilt als Härtefall und wie belege ich ihn?
Härtefälle können gesundheitlicher, sozialer oder familiärer Natur sein: z. B. schwere Krankheit, hohes Alter, Schulbindung der Kinder, fehlender Ersatzwohnraum oder psychische Belastung durch einen Umzug. Belegt wird der Härtefall durch Atteste, Bescheinigungen oder Nachweise über erfolglose Wohnungsbewerbungen. Wichtig ist eine frühzeitige, vollständige Dokumentation.
Bis wann muss ich Widerspruch einlegen?
Der Widerspruch muss dem Vermieter spätestens zwei Monate vor dem Kündigungstermin vorliegen. Wird diese Frist versäumt, verliert der Mieter sein Recht auf die Härtefallprüfung durch das Gericht. Der Widerspruch sollte begründet und möglichst mit Belegen versehen sein – idealerweise schriftlich per Einschreiben.
Was passiert, wenn ich nicht ausziehe?
Zieht der Mieter trotz wirksamer Kündigung nicht aus, muss der Vermieter Räumungsklage erheben. Bis zum Urteil kann es Monate dauern, eine Zwangsräumung darf nur durch einen Gerichtsvollzieher erfolgen. Ohne Titel darf der Vermieter den Mieter weder aussperren noch das Schloss austauschen.
Kann ich eine Entschädigung verlangen?
Ein gesetzlicher Anspruch auf Entschädigung besteht nicht. In der Praxis kommt es aber häufig zu Aufhebungsverträgen mit Umzugspauschalen oder Abstandszahlungen, insbesondere wenn der Mieter sonst nicht freiwillig geht. Solche Vereinbarungen sollten stets schriftlich und rechtlich überprüft abgeschlossen werden.
Wie lange darf ich in meiner Wohnung bleiben?
Die gesetzliche Kündigungsfrist richtet sich nach der Dauer des Mietverhältnisses: bei bis zu 5 Jahren beträgt sie drei Monate, ab 5 Jahren sechs Monate, ab 8 Jahren neun Monate. Bei anerkannten Härtefällen kann das Gericht die Frist verlängern oder sogar die Kündigung insgesamt zurückweisen.